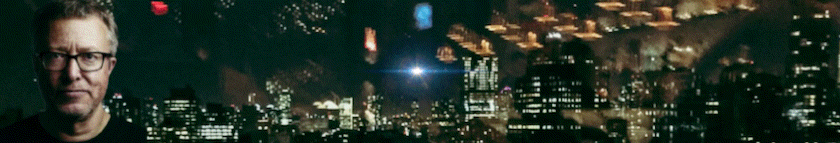(Aus: Programmblatt „Jazz Haus Konzerte“, Jan/Feb 1980)
Zur Vorgeschichte:
Das Jahr 1979 brachte für die „alternative“ oder „fortschrittliche“ Kulturszene in Köln Entscheidungen, die die weitere kulturelle Entwicklung in dieser Stadt nachhaltig beeinflußen sollte.
Zumindest für den Jazz begann das Jahr sehr hoffnungsvoll. Am 13. Januar 79 fand das erste Jazz-Hearing in einem deutschen Rathaus statt, ein neuer Kulturdezernent stand vor der Tür und alle Fraktionen bereiteten sich mit aufgeblasenen Backen auf die kommenden Kommunalwahlen vor.
So hatten auch zwei Gruppierungen, die sich anfangs zusammen, später konkurrierend dem Ziel verschrieben hatten, den Jazz aus dem Schattendasein des Kölner Kulturlebens zu führen, berechtigte Hoffnung auf eine kulturelle Wendung.
Streitobjekt war das ehemalige Stadtgartenrestaurant an der Venloer Straße in Köln.
Die eine Gruppe, die Initiative Kölner Jazz Haus eV (IKJH), die in erster Linie von allen Kölner Jazz-Musikern getragen wird und den überwiegenden Teil der nicht etablierten Kulturszene hinter sich weiß, existierte schon seit dem Frühjahr 78 und hatte durch ihre Aktivitäten (Festivals, Feste, Konzerte, Workshops usw.) den Jazz und die damit verbundenen Anliegen in die öffentliche Diskussion gebracht.
Die andere Gruppe, der Jazzboard Köln eV (JB), gründete sich kurze Zeit nach o. g. Hearing und besteht aus Jazz-begeisterten Geschäftsleuten (sog. Aficionados), die, wie sich heute immer mehr bewahrheitet, keinen Finger krümmen, ohne einen entsprechenden materiellen Gegenwert zu erhalten.
Für die meisten Politiker zumindest war diese Situation unverständlich: Jetzt hatten es Leute in Köln geschafft, daß der Jazz ernst genommen wurde und man ihn (und damit gleichzeitig verwandte Kulturarten) von städtischer Seite unterstützen wollte – da gab es plötzlich zwei Gruppierungen, die sich gegeneinander um das gleiche Haus und die dazugehörige Unterstützung bewarben.
Um diesen lähmenden Konflikt zu beenden, machte die IKJH bereits am 24.4.79 dem Jazzboard den Vorschlag einer paritätischen Trägerschaft des Hauses. Dieser Kompromiß-Vorschlag war das Ergebnis eines vorangegangenen Treffens der Vorstände beider Vereine (jedoch ohne den 1. Vorsitzenden des JB, Gigi Campi). Mit Schreiben vom 27.4.79 teilte der Vorstand des JB daraufhin mit, daß „der jetzige Zeitpunkt zu einer erneuten Beratung über eine eventuelle gemeinsame Nutzung des ehemaligen Stadtgartenrestaurants uns leider noch als verfrüht erscheint“. Dies war der letzte Versuch den Konflikt zu beenden.
Wenige Wochen später traf Peter Nestler als neuer Kulturdezernent in Köln an. Mit vielen Vorschußlorbeeren bedacht, als Förderer alternativer Kulturschaffender und als unverwüstlicher lntegrator sozialer Randgruppen. Auf ihn hatte man gewartet, dieses „leidige Problem“ zu lösen – und er fand, wie sich später herausstellen sollte, eine verblüffend einfache Lösung.
Meinungsbildung:
Nun gab es für beide Vereine mehrere gangbare Möglichkeiten ein Problem (hier: Raumproblem) aufzuzeigen und Politiker zur Abhilfe zu bewegen. Die IKJH wählte den Weg über die aktive kulturelle Arbeit, den Bedarf und die mögliche Perspektive eines von ihr geführten Hauses in die öffentliche Diskussion zu bringen.
Der JB beschränkte sich auf die Pflege bereits bestehender Kontakte zur kölschen Sozialdemokratie und der Erstellung einer wohlfeilen Konzeption zur Nutzung des Hauses, Die öffentliche Diskussion wurde gescheut. Um jedoch nachhaltig den Eindruck zu erwecken, daß es eine Öffentlichkeit gibt, die hinter dem JB steht, wurde eine Liste der Mitglieder und Förderer beigelegt. Diese mehrere hundert Namen umfassende Liste löste jedoch bei einigen angeblichen Förderern Verwunderung aus. Der Kölner Geschäftsmann Günter Steigl dazu: „ . . ich möchte Sie darauf hinweisen, daß die von Herrn Campi vorgezeigte Liste der Förderer und Mitglieder des Jazzboard manipuliert ist und keinesfalls den Tatsachen entspricht. Mein Name, und ich bin sicher auch ca. 80% der Namen, die in dieser Liste genannt sind, wissen gar nichts von ihrem Glück.“ (Zitat aus einem Brief an die Kölner SPD-Fraktion vom 27.11.79)
Gigi Campi bestätigte danach dem Kölner Stadt-Anzeiger, daß sein Verein tatsächlich erst 35 Mitglieder habe.
Heute kann festgestellt werden, daß weder der JB noch führende Kölner(Kultur) Politiker Interesse an einer öffentlichen Diskussion, geschweige denn an einer Problemlösung, die dem tatsächlichen Bedarf entspricht, hatten.
lm Gegenteil, dem Kulturdezernat ist es gelungen, für die ohnehin mit beschriebenem Papier übersättigten Rats- und Ausschußmitglieder eine umfangreiche Vorlage zusammen zustellen, die in Form einer Synopse die Meinungsbildung innerhalb der Fraktionen endlich zu Gunsten des JB erstickte. In dieser Vorlage stellte man Punkt für Punkt die wohlwollend interpretierte JB-Konzeption der negativ ausgelegten Konzeption der IKJH gegenüber.
Ergebnis:
Am 20.11.79 war es dann soweit. lm Kulturausschuß bedankten sich die Sprecher der SPD und CDU Fraktion für die „ausgezeichnete Vorlage“. Sie schlossen sich der Intention der Vorlage an, dem Jazzboard die Trägerschaft alleine zu überlassen und führten aus, daß man jedoch nur zustimme, wenn vertraglich gesichert sei, daß die IKJH angemessene Berücksichtigung finde.
Als Grund für diese Entscheidung stützte man sich auf das Argument, daß der JB wohl Garant für eine ordnungsgemäße Betriebsführung sei, und was unausgesprochen blieb, wohl aber noch mehr zählte, daß er auch Garant für eine inhaltliche unpolitische und konservative Kulturauffassung ist.
Lediglich der Sprecher der FDP-Fraktion, Klaus Burkhard, protestierte und stimmte gegen die Vorlage – doch was nützte es?
Die IKJH hat also mit ihren Bestrebungen, in Köln ein Haus zu installieren, das von Musikern mitgetragen wird, indirekt genau das Gegenteil erreicht:
Bald gibt es in Köln ein Live-House (so der Name des JB-Projektes) mit einem Mann an der Spitze, der nicht das Vertrauen eines einzigen Kölner Jazz-Musikers besitzt, mit einem Geschäftsführer, der 6500.- DM mtl. verdienen soll, ein Haus in dem jährlich alleine 10.000.- DM nur aus Garderoben-Einnahmen erwirtschaftet werden sollen. Ein Haus, das für mehrere Millionen DM von der Stadt Köln umgebaut werden soll (der Architekt, der die Umbaupläne entwickelt hat und dafür Honorar erhalten wird, ist übrigens identisch mit dem zukünftigen Geschäftsführer), und das dann dem JB nicht nur mietfrei, sondern voll subventioniert zur Verfügung gestellt werden soll.
Ein Haus mit einem 300 Personen fassenden Saal in dem die „Dubliners“ (die alleine schone Sporthallen füllen) auftreten sollen. Kultur für alle oder viel Kultur für wenige?
Konsequenzen für die IKJH
Die IKJH hatte schon anläßlich einer früheren Kulturausschußsitzung am 8.8.79 verlautbaren lassen, daß sie bei einer Vergabe der Trägerschaft an den Jazzboard, sich nicht an diesem Haus beteiligen wird. Dies hat mehr als einsehbare Gründe: Alle wichtigen personellen und inhaltlichen Entscheidungen trifft der Trägerverein, und er trägt letztlich auch die gesamte Verantwortung.
Man kann von einer kulturpolitisch bewußten Musiker-lnltiative nicht verlangen, sich wieder nur auf das „Musik Machen“ zu reduzieren. Eine Mitarbeit der Musiker bei dem Projekt „Livehouse“ würde ihnen die Möglichkeit nehmen, sich im Kulturbetrieb als die eigentlichen „Macher“ von Kultur zu emanzipieren; das Livehouse erstrebt genau das Gegenteil: Es wird ein Denkmal für restriktive und konservative Kulturpolitik und ein Bauwerk für die mächtigen Vermittler des Kultur-Geschäfts.
Der Kulturdezernent Peter Nestler hat ein Zeichen für seine künftige Kulturpolitik gesetzt.
Diejenigen, die von ihm Objektivität und Gerechtigkeit in Bezug auf die Vergabe von öffentlichen Geldern erwarteten, sind eines Besseren belehrt, und die, die auf seine Integrationsfähigkeit hofften, müssen nun erkennen, daß Integration um jeden Preis nicht immer sinnvoll ist: Man nehme ein Schaf und einen Wolf, sperre sie in einen gemeinsamen Käfig, reinige diesen nach kurzer Zeit von Knochenresten und fertig ist die Integration.
Die Kölner Musiker haben erkennen müssen, daß es nicht Argumente oder ansehbare Sachverhalte gab, mit denen man ihnen die Übernahme von kulturpolitischer Verantwortung verweigerte. Schuld ist ein Mechanismus, der überall dort zerstörend auftaucht, wo neue Ideen beginnen stark zu werden. Würde die IKJH sich nun wieder mit dem gleichen Ziel, dem eines Hauses, an die Politiker heranmachen, so hätte sie tatsächlich nichts gelernt.
Es wird in Köln erforderlich sein, die „alternative“ oder „fortschrittliche“ Kulturszene zu einem Machtfaktor auszubauen, der unabhängig von öffentlichen Geldern ist und aus dieser Unabhängigkeit heraus konstruktiven Druck auf kulturpolitische Vorgänge ausübt und so die Hoffnung läßt, daß vielleicht in dieser Stadt doch noch etwas zu retten ist.
Köln, Dezember 1979