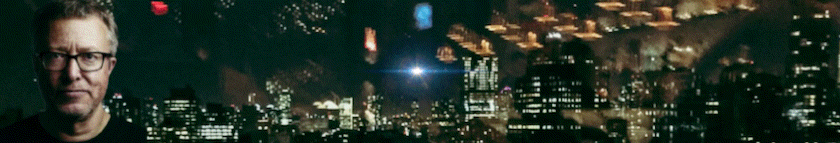(Aus: Jazzthetik – Das Magazin für Jazz und Anderes, März 2006)
Der Monat März steht im Zeichen der Jazzmesse jazzahead! Und die Frage lautet, für wen diese Messe eigentlich von Interesse ist. Für Jazzfans? Oder auch für Veranstalter, Hochschulen, Musiker und – für die Wirtschaft?
Von Harald Justin
Deutscher Jazz?!
Dem deutschen Jazz soll auf der Jazzmesse jazzahead! ein Forum gegeben werden. Wer oder was ist aber der deutsche Jazz? Zum deutschen Jazz gehören, so dürfte die Spontanantwort lauten, wohl doch vor allem Musiker wie Christof Lauer, Julia Hülsmann, Michael Schiefel, Thärichens Tentett oder auch Nils Wogram, die allesamt auch auf der jazzahead! auftreten werden. Man kennt sie, die Musiker und Gruppen. Weil man sie entweder schon einmal live gesehen und gehört hat, und möglicherweise besitzt man sogar die eine oder andere CD von ihnen. Die Künstler stehen halt im Rampenlicht. Zum deutschen Jazz, so die notwendige Ergänzung, gehören demnach aber auch die Veranstalter, die für die entsprechenden Live-Auftritte sorgen; zum deutschen Jazz gehören auch die Tonträgerlabel; zum deutschen Jazz gehört auch eine Ökonomie. Sowohl von den Veranstaltern und Machern, die eben nicht im Rampenlicht stehen, die gleichwohl aber den Jazz erst ermöglichen, ist selten etwas zu hören und zu lesen. Grund genug, einmal mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Jazz und Politik
Die ersten Fragen gingen an Reiner Michalke. Er ist ein viel beschäftigter Strippenzieher hinter den Kulissen, u.a. Programmchef im Kölner Stadtgarten, ab 2006 künstlerischer Leiter des Moers-Festivals, Vorstandsmitglied im Europe Jazz Network (www.europejazz.net), Mitglied in der Bundeskonferenz Jazz – und wollte man alle seine Aktivitäten aufführen, bräuchte es mehr als eine eng beschriebene DIN-A4-Seite. Darum nur der Hinweis auf seine Website: www.reinermichalke.de
Harald Justin: Welchen Stellenwert hat der Jazz in der Gesellschaft? Welchen sollte er haben?
Reiner Michalke: Hier in der Bundesrepublik hat der Jazz als Kunstform einen denkbar geringen Stellenwert. Ein finnischer Kollege hat es vor kurzem auf den Punkt gebracht, als er sagte, »Ihr seid immer noch da, wo wir vor 20 Jahren waren.« Und ich ergänze: Nicht nur im Bereich des Jazz. Dafür gibt es zahlreiche Gründe: Ich kenne keinen Politiker in keiner Partei in Deutschland, die oder der sich ernsthaft mit dem Thema »Jazz« beschäftigt hat. (Ich nehme jetzt einmal den Moerser Bundestagsabgeordneten Siggi Ehrmann als Ausnahme von dieser Regel aus.) Und ich vermute, dass es keinen Politiker gibt, der diese Zeitschrift oder gar dieses Interview liest. Falls doch, soll sie/er sich auf der Stelle melden und mir widersprechen.
Leider gilt dies nicht nur für Politiker, sondern auch für andere Multiplikatoren in unserer Gesellschaft wie z.B. Musiklehrer an gemeinbildenden Schulen, Kulturreferenten, Redaktionsleiter, Marketing-Chefs etc. Jazz findet in Nischen statt. Und vielen gefällt es in dieser Nische. Sie sind damit definitiv anders als die anderen und bewahren ihr Geheimnis für sich. Wolfram Knauer (vom Jazzinstitut in Darmstadt) hat kürzlich vorgeschlagen, eine Outing-Kampagne von Jazzfans zu starten. Also Prominente aufzufordern, ihr Interesse, ihre Leidenschaft (oder was auch immer sie für den Jazz empfinden) öffentlich zu machen. Eine gute Idee, finde ich.
Ich habe mich oft gefragt, warum es gerade in Deutschland eine solche Distanz zum Thema Jazz gibt. Okay, wir reden über eine Kultur, deren Wurzeln irgendwo zwischen Afrika und Nord-Amerika liegen, deren bedeutende Protagonisten im 20. Jahrhundert fast ausnahmslos schwarze Hautfarbe hatten und die – die Musikwissenschaftler mögen mir verzeihen – so ziemlich genau das Gegenteil von dem vermittelt, was uns Wagner und Mahler sagen wollten. Aber dennoch: Zumindest den Aufgeschlossenen kann doch nicht entgangen sein, dass da seit den frühen 70er Jahren auch hier in Europa eine eigene Form »Improvisierter Musik« entstanden ist. Ein weiterer Aspekt ist unsere föderale Struktur, die es unglaublich schwer macht, neue Themen in den kultur-gesellschaftlichen Kanon Alt-Germaniens einzubringen.
Harald Justin: Du bist einer jener Kulturarbeiter, die mit viel Lobbyarbeit – hinter den Kulissen – Jazz in Deutschland möglich machen. Wieso ist diese Lobbyarbeit im politischen Raum für den Jazz so wichtig?
Reiner Michalke: Ambitionierte Kunst, die sich nicht an den Regeln des Marktes orientiert, kann dauerhaft nicht ohne fremde Hilfe existieren – und sie kann sich schon gar nicht entwickeln. Trifft diese Subvention, die nicht nur aus öffentlichen, sondern auch aus öffentlich-rechtlichen und privaten Quellen stammen kann, nicht ein, entsteht ein von Ehrenamt und Amateurtum geprägtes System aus Künstlern, Veranstaltern und Berichterstattern. Solche Systeme haben die schlechte Angewohnheit, nur selten die besten künstlerischen Ergebnisse zu produzieren. Das Ganze funktioniert trotzdem irgendwie, solange die Musiker auf eine angemessene Honorierung verzichten und damit ihre eigenen Subventionsgeber sind. Das kann aber nicht im Sinne der Sache sein. Vor allen Dingen, wenn sie sich irgendwann auch international behaupten wollen, müssen Musiker die Perspektive bekommen, vom Spielen ihrer Musik leben zu können. Und die besten von ihnen müssen auch gut davon leben können.
Unsere Nachbarn in Skandinavien, Holland, Frankreich und zunehmend auch in einigen mitteleuropäischen Ländern machen uns vor, wie es geht: Geld in die Hand nehmen und möglichst früh anfangen, am besten schon im Kindergartenalter, ein kulturell interessiertes und aufgeschlossenes Publikum heranzubilden. Dann kommt der Rest von alleine. Dann gibt es irgendwann auch Politiker, Kulturreferenten und Marketing-Chefs, die wissen, was gut ist. Und dann werden sie auch die Qualitäten der Improvisierten Musik zu schätzen wissen.
Harald Justin: Wie schätzt du die jazzahead! ein? Ist das eine Messe hauptsächlich für Veranstalter oder ist sie auch für ein breiteres Publikum interessant?
Reiner Michalke: Ich glaube, dass die jazzahead! genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Alle Kräfte, die irgendwie am Jazz in Deutschland beteiligt sind, werden hier zum ersten Mal Gelegenheit haben, sich als ernst zu nehmenden Faktor und in der Summe als eine relevante kulturelle und gesellschaftliche Kraft zu zeigen und zu begreifen. Das hohe Maß an Professionalität, mit der die Bremer Messe dieses Unternehmen angeht, wird hier ihr Übriges tun. So ist weniger das breite Publikum Zielgruppe dieser Messe, als vielmehr die im besten Sinne professionellen Akteure. Für die breite Masse wichtig werden allerdings die Signale, die über die Medien von der jazzahead! verbreitet werden. Und die Hauptbotschaft wird lauten: Wir sind da!
Zusätzlich zum Kongress gibt es ja noch ein Festival und das German Jazz Meeting. Das ist ohne Zweifel auch für ein größeres Publikum interessant.
Harald Justin: Es heißt, Jazz solle sich besser verkaufen. Mit anderen Worten: Jazzmusiker sollen lernen, sich und ihre Ware nach den Gesetzen des Marktes zu präsentieren. Was können Musiker von den Gesetzen des Marktes lernen?
Reiner Michalke: Natürlich wäre es schön, wenn sich Jazz besser verkaufen würde. Es wäre aber ein Fehler, diesen Druck alleine auf die Musiker abzuwälzen. Wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch ist es immer die Entscheidung des Konsumenten, für welches Produkt er sich entscheidet. Jemand, der sein Fleisch beim Bio-Metzger – statt »Gammelfleisch« im Supermarkt – kauft, traue ich durchaus zu, auch bei seiner Musikauswahl bewusst vorzugehen. Wer allerdings, um ein anderes Beispiel zu nennen, in einem Starbucks sitzt und sich für supercool hält, während das kleine Café um die Ecke ums Überleben kämpft, ist für uns als Kunde schwerer zu erreichen. Noch einmal, Musiker sollen ihr Ding machen, und wir alle gemeinsam müssen auf die Mündigkeit des Käufers setzen und mit dessen Ausbildung möglichst früh beginnen.
Harald Justin: Kann der Markt etwas vom Jazz lernen?
Reiner Michalke: Die Frage ist, will der Markt etwas vom Jazz lernen? Schön wäre es, wenn Märkte so funktionieren würden, wie wir uns das vorstellen. Dann würde sich nämlich Qualität durchsetzen – und Bill Gates wäre nicht so unverschämt reich. Leider ist es so, dass die Globalisierung der Märkte dazu führt, dass immer weniger Produkte für eine immer kleiner werdende Welt hergestellt werden. Eine Musik für die ganze Welt ist eben profitabler als viele Musiken für viele Welten. Wenn also der Jazz den Markt wie ein Virus befallen würde und Qualität statt Quantität, Vielfalt statt Einheitlichkeit und Nachhaltigkeit statt Kurzlebigkeit die maßgebenden Kriterien wären, würde unser gesamtes Wirtschaftssystem nicht mehr funktionieren. Dann wären allerdings die im Vorteil, die improvisieren können. Ich bleibe dabei, wir müssen auf Qualität setzen, auch wenn das nicht der leichteste Weg ist.